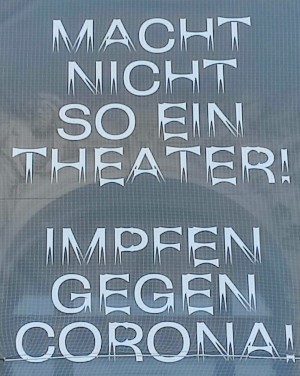Frauenleben Frauenleiden
Emma ist mit ihrem Germanistikstudium unzufrieden und möchte lieber Sprachkunst studieren.
Leider wurde sie an der Hochschule nicht aufgenommen. So beschließt sie einen Roman über
das moderne „Frauenleiden” zu schreiben und bekommt von ihrem Großonkel Bernhard,
einem ehemaligen Lektor, den „Faust”, Fontanes „Effi Briest” und die „Fromme Helene’
in die Hand gedrückt.
|
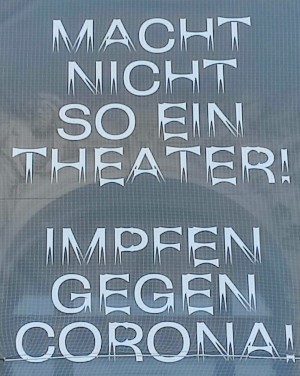 |
1.
„Scheiße!”, fluchte Emma Baldinger vor sich hin und blickte das vor ihr liegende Briefblatt grimmig an.
„Sehr geehrte Frau Baldinger!”, stand darauf zu lesen.
„Leider müssen wir Ihnen mitteilen, daß wir Sie im nächsten Jahrgang der Hochschule für Sprachkunst nicht aufnehmen können, da Sie die dazu nötige Punktezahl nicht erreicht haben! Lassen Sie sich nicht entmutigen und reichen Sie im nächsten Semester wieder ein! Mit freundlichen Grüßen! Für den Rektor, Horst Schneider!”
„Verdammt, verdammt!”
Das Briefblatt zusammenknüllen und auf die orange Zeitschrift fallen lassen, die auf dem Schreibtisch lag.
„Autorensolidarität – Nachrichten der IG Autoren!”
Die hatte sie vor einem Jahr, als sie merkte, daß ihr Germanistikstudium nicht das war, was sie sich erwartet hatte, hoffnungsvoll abonniert. Denn eigentlich wollte sie eine berühmte Schriftstellerin werden, auch wenn Großonkel Bernhard, der in seinen besten Jahren „Suhrkamp-Lektor” gewesen war, sich aber längst in Pension befand und von Frankfurt in seine Wiener Wohnung zurückgekommen war, beim weihnachtlichen Pflichtbesuch die Nase gerümpft hatte.
„Verrenn dich nicht, Kindchen! Komm auf den Boden der Realität zurück! Was glaubst du, was wir mit den vielen unverlangten Manuskripten machten, die täglich bei uns eingetroffen sind?”
Der jeweiligen Praktikantin oder Volontärin auf den Arbeitsplatz legen, damit sie es mit dem vorgedruckten Absagebrief zurückschicken oder gleich schreddern konnte. Das wußte sie schon, daß das in Großonkel Bernhards aktiven „Suhrkamp-Zeiten” so geschehen war. Jetzt kamen die hoffnungsvoll eingeschickten Manuskripte per PDF und wurden solcherart retourniert oder gelöscht. Das wußte sie ebenfalls und gleichfalls war in der langweiligen Mittelhochdeutschpflichtvorlesung zu ihr gedrungen, daß es seit einigen Jahren einen Hochschullehrgang für Sprachkunst gab, in dem man Dichter werden konnte. Allerdings war diese Spezialausbildung, die auch die meisten ihrer Mitstudenten interessierte, die ebenfalls lieber Schriftsteller statt ausgebrannte AHS-Lehrer oder unbezahlte Praktikanten werden wollten, sehr begrenzt. Mußte doch nach der Bewerbung ein mehrteiliges Auswahlverfahren absolviert werden. Dann wurden von den hunderten Bewerbern fünfzehn bis zwanzig aufgenommen und sie war, was eigentlich zu vermuten war, nicht dabei.
„Verdammt, verdammt!”, fluchte Emma wieder vor sich hin. Ballte die Hände zu Fäusten und griff nach der orangefarbigen Zeitschrift, die sie vor einem Jahr abonniert hatte, als sie Mitglied bei der österreichischen Autorenvereinigung geworden war, nachdem eine ihrer Kurzgeschichten in einem kleinen, nur im Netz zugänglichen Literaturforum erschienen war. Seither nannte sie sich schreibende Frau und wollte das, auch wenn Onkel Bernhard einen Schreikrampf bekommen würde. Aber Onkel Bernhard war seit fünfzehn Jahren weg vom beruflichen Fenster und seit zwei Jahren, als seine geliebte Rosi an einem unheilbaren Krebs zu leiden begonnen hatte, überhaupt sehr betroffen. Vor drei Wochen war die Tante gestorben. Emma war mit ihrer Mutter, die aus Linz, wo sie mit ihrem Lebenspartner wohnte, nach Wien gekommen war, auf dem Begräbnis gewesen und da hatte ihr die Mutter das Versprechen abgenommen, sich um den Onkel zu kümmern.
„Ich glaube, es geht ihm nicht sehr gut und wird ein Leben ohne seine Rosi vielleicht nicht schaffen! Sei doch so lieb und besuch ihn öfter! Schau, ob er mit seiner Bedienerin, die drei Stunden in der Woche bei ihm putzt, zurechtkommt und ob er regelmäßig ißt? Du kannst mit ihm auch über Literatur diskutieren! Das heitert den alten Haudegen vielleicht auf und du hast auch etwas davon, da mir ein Vögelchen flüsterte, daß dein Germanistikstudium nicht das zu halten scheint, was du dir erwartet hast!”, hatte die Mutter, die in Linz Finanzbeamtin war, zu ihr gesagt, bevor sie in den Zug gestiegen war.
„Richtig, Mama, könnte ich! Ist Onkel Bernhard doch ein kompetenter Mann, der mir das Mittelhochdeutschseminar vielleicht schmackhafter machen kann!”, dachte Emma und schlug das orange Heft auf. Ob der Onkel die Zeitschrift ebenfalls abonniert hatte? Aber der war zwar ein leidenschaftlicher Leser, schrieb aber nicht selber und riet ihr auch immer davon ab.
„Damit wirst du nur frustriert und fällst Betrügern in die Hände, die dein Geld für ihre Selbstzahlverlage haben wollen und wenn du dich unter die Selfpublisher mischst, die jetzt modern sind, wirst du auch nur enttäuscht, weil du es damit nicht in den Literaturbetrieb schaffst!”, hatte er prophezeit und über die Ausschreibungen und Wettbewerbe geschimpft, die die hoffnungsvollen Germanistikstudenten, die alle mehr oder weniger auf den Nobelpreis hofften, in die Irre führten und dorthin war sie auch gekommen, denn die „Autorensolidarität der IG-Autoren” bot ihren Lesern den Service an, sie über die Ausschreibungen zu informieren, wohin dann die hoffnungsvoll geschriebenen Manuskripte geschickt werden konnten. Unter dem Titel „Frauenleben- Frauenleiden”, wurde da beispielsweise ein Roman gesucht, der die Frauenbewegung neu beleuchten sollte und wofür, wenn man in die engste Auswahl kam, ein Verlagsvertrag angeboten wurde. Wenn sie da einen Roman zusammenbrächte, würde sie vielleicht einen Vertrag bekommen und wenn sie sich mit einer Textprobe im nächsten Semester am Institut für Sprachkunst wieder bewarb, würde sie möglicherweise aufgenommen und konnte ihr Studium wechseln, wenn sie sich nicht länger mit den Mittelhochdeutschseminaren oder langweiligen Textanalysen abquälen wollte, dachte Emma hoffnungsvoll und seufzte nochmals auf. Dann griff sie zum Rotstift, der am Schreibtisch in einer alten Kaffeebüchse aufbewahrt wurde, strich sich den Ausschreibungstext an und beförderte den Absagebrief in den Mistkübel.
„Verdammt, verdammt!”, neuerlich fluchen und nach dem Handy greifen, auf dem sie das Bild ihrer Mutter erkannte, die sie daran erinnerte, daß sie sich um den Onkel kümmern sollte.
„Warst du schon bei ihm, Kindchen? Hast du nachgesehen, daß er in seiner Altbauwohnung nicht versumpert? Ich würde es selber tun und öfter nach Wien fahren! Du weißt aber, ich habe nur wenig Zeit! Der Alois braucht mich und im Amt ist auch der Teufel los! Telefonisch läßt sich das nicht gut erledigen, weil der Onkel nicht mehr so gut hört! Aber von der Albertgasse hast du es nicht weit zu ihm! Da kommst du auch bei deinen geliebten Bücherkästen vorbei und kannst dem Onkel etwas Interessantes bringen!”