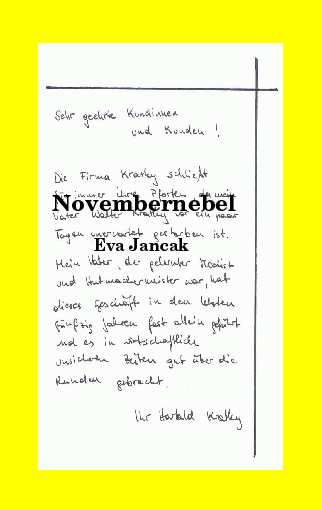Novembernebel
Einen Monat vor ihrem achtzigsten Geburtstag bekommt Emma
Huber einen Brief in dem sie aufgefordert wird „ihrer
staatsbürgerlichen Verpflichtung nachzukommen und sich im allgemeinen
Interesse selber zu entsorgen!”, was die alte Frau, die ihr ganzes
Leben lang für die Interessen und der Pflege ihrer Familie
dagewesen ist, erkennen läßt, da sie ihre Tochter Sophie,
die eine arbeitslose Schauspielerin und prekäre Beschftigte eines
Callcenters ist, sowie ihre Enkeltochter Ilona, die Germanistik studiert
und gerade ihre Diplomarbeit schreibt, im letzten Jahr nur sehr
wenig gesehen hat.
In weiterer Folge wird sie in ein Kriminalrätsel verwickelt, das
bis in die freiheitliche Parteipolitik und zu einer Schweizer
Sterbehilfeorganisation hinführt, das sie mit Hilfe eines an Krebs
erkrankten Jugendfreundes und ehemaligen Spiegelgrundopfers
aufklären will.
|
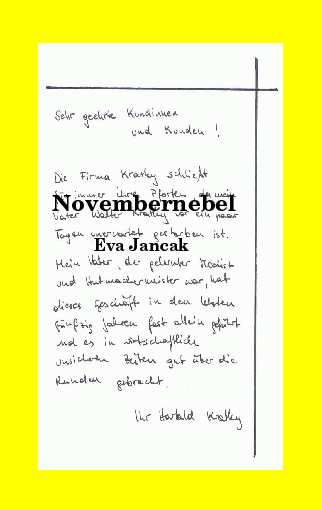 |
1.
Der Brief lag bei den Poststücken, die Emma Huber heraufgebracht hatte,
als sie im Pennyladen Milch und Brot besorgt hatte. Sie hatte ihn unter
den Reklamezetteln, die hauptsächlich im Hausbriefkasten lagen, seit
man davon abgekommen war, sich Briefe und Postkarten zu schicken, gar
nicht gesehen. Erst als sie sich an den Küchentisch setzte, um die
Supermarktangebote zu studieren, fiel er in ihre Hand.
„Sonderbar!”, dachte die alte Frau und rückte die Brille, die von
ihrer Nase ein wenig nach vorne gerutscht war, wieder zurecht.
„Höchst sonderbar!”
Durch das glatte Kuvert, das jetzt in ihrer Handfläche lag und darauf
wartete, geöffnet zu werden, wurde ihr so recht bewußt, daß sie lange
keinen solchen mehr erhalten hatte. Was nicht außergewöhnlich war,
schrieb man sich doch keine Briefe mehr, außerdem fehlt es, wenn man
beinahe achtzig ist, zumeist an Kontakten. Waren die Eltern, die Tanten
und Cousinen doch lang dahingegangen und auch die Freundinnen, viele
waren es ohnehin nicht gewesen, waren allmählich gestorben und da auch
Erwin vor einem Jahr einem Krebsleiden erlegen war, gab es nur mehr
Sophie und Ilona, die Tochter und die Enkeltochter und die hatten auch
nicht geschrieben, als noch nicht alle auf eine Internetelektronik
versessen waren, von der sie nicht viel verstand. Beinahe achtzig Jahre,
da hatte sie es. In einem Monat hatte sie Geburtstag. Das war ihr
eingefallen, als sie auf den Kalender gesehen hatte. Heute war der
fünfundzwanzigste Oktober und am fünfundzwanzigsten November wurde
Emma Huber achtzig Jahre alt. Der Brief kam bestimmt vom Bürgermeister
oder Bezirksvorsteher, um ihr zu ihrem Ehrentag zu gratulieren. Warum
war ihr das nicht schon früher eingefallen? Konnte sie sich doch
erinnern, daß Erwin vor drei Jahren ein solcher Brief ins Haus geschneit
war und auch er war erstaunt gewesen, da er außer seiner Frau, der
Tochter und der Enkeltochter, niemanden hatte, dem es einfiel, zum
Geburtstag zu gratulieren. Seltsam nur, daß das Stadtwappen oder die
entsprechende Magistratsadresse auf dem Kuvert fehlte. Bei Erwins
Glückwunschschreiben war das nicht so gewesen. Also war es doch nicht
der übliche Geburtstagswunsch, es wäre auch zu früh dazu. Um dem
Rätsel auf die Spur zu kommen, war es besser das Kuvert aufzureißen
und das Briefblatt herauszunehmen. Gedacht, getan. Emma Hubers Hand
zitterte, als sie die weiße Seite, die wohl doch kein Glückwunsch war,
herausholte, die Brille zurechtrückte und das Blatt dicht unter ihre
Augen hielt. Die Hände zitterten sogar sehr, denn der Inhalt, der mit
der Schreibmaschine oder richtiger mit einem dieser Computer, von denen
sie nicht viel verstand, geschrieben und ausgedruckt worden war, war
wirklich sonderbar und auch ein wenig furchteinflößend.
„Sehr geehrte Adressatin! Wir erlauben uns, Sie an Ihren Geburtstag
Ende nächsten Monats zu verweisen. Da Sie zu diesem Datum achtzig
werden und ein langes Leben hinter sich haben, fordern wir Sie auf, an
die knappen volkswirtschaftlichen Resourcen zu denken und erwarten,
daß Sie Ihrer staatsbürgerlichen Verpflichtung nachkommen und sich im
allgemeinen Interesse selbst entsorgen! Wenn wir Ihnen mit
fachkundlichem Rat und Tat zur Seite stehen können, wenden Sie sich
vertrauensvoll an uns! Unter www.todt.at stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Ansonsten verbleiben wir mit hochachtungsvollen Grüßen und bestem Dank
für Ihr Verständnis! Im Auftrag der Allgemeinheit! Hans Uwe Todt.”
Emma Hubers Hand zitterte und ihre schon ein wenig schwachen Augen
mußten den Computerausdruck mehrmals überfliegen, bis sie die Zeilen
verstand, die sie aufregten, auch wenn sie über die umständlich
klingenden
Formulierungen ein wenig lächeln mußte. War doch der Inhalt als
Frechheit oder Drohung zu verstehen.
„Eine Frechheit oder eine Drohung?”, wiederholte Emma und
schüttelte ratlos den Kopf. Wie sollte sie diese Aufforderung zum
Selbstmord, das war es wohl, verstehen? War es ein dummer Scherz oder
ernst zu nehmen? Auf jeden Fall war diese Botschaft viel beunruhigender,
als des Bürgermeisters unverbindliches Glückwunschschreiben, das
Erwin vor drei Jahren erhalten hatte.
Wie sollte sie den Brief verstehen?, fragte sich Emma immer noch ein
wenig hilflos und überlegte, bei wem sie sich erkundigen konnte. -
Erwin lebte nicht mehr und Sophie, die vor kurzem fünfzig geworden war,
wohnte nicht bei ihr und genauso war das bei Ilona, der Enkeltochter. Da
fiel ihr ein, daß sie die beiden länger nicht gesehen hatte. Bisher
war ihr das nicht so aufgefallen. War Sophie ja berufstätig und Ilona
schrieb gerade ihre Dissertation oder Diplomarbeit. Da war es klar,
daß die beiden nicht viel Zeit hatten. Wenn sie darüber nachdachte, fiel
ihr das Begräbnis und der anschließende Leichenschmaus, bei dem sie
sich das letzte Mal gesehen hatten, ein. Nein, das stimmte nicht ganz.
Zu Weihnachten waren die beiden gekommen, hatten ein Gesteck und einen
Geschenkkorb mit Kaffee und Süßigkeiten mitgebracht. Ilona hatte sie
zu ihrem Geburtstag telefonisch gratuliert, da die Enkeltochter ein
Studiensemester im Ausland war und zu Sophies Geburtstag hatten sie in
einem italienischen Restaurant Pizza gegessen und Chianti getrunken und
die Tochter hatte ihr von ihren Sorgen erzählt, die sie in dem
Callcenter hatte, in dem sie ihren Unterhalt verdiente, weil es ihr
nicht gelungen war, als Schauspielerin die Karriere zu machen, die sie
sich erträumte. Das war es und es war sicherlich keine böse Absicht,
denn Sophie war eine gute Tochter, die sich sehr um sie kümmerte. Im
letzten Jahr hatten sie sich aber nicht sehr oft gesehen. Emma war das
gar nicht aufgefallen. War sie ja trotz ihrer beinahe achtzig Jahre
gesund und rüstig und hatte das Jahr, da sie Erwins Pflege sehr
aufgerieben hatte, zur Erholung benötigt, so daß sie gern alleine war
und sie war auch gut damit zurechtgekommen. Aber jetzt war ihr dieser
Brief ins Haus geschneit, der sie verwirrte und über den sie sich gern
mit Sophie oder Ilona unterhalten hätte. Zu ihrem Geburtstag würden
die beiden sie besuchen. Das war klar und selbstverständlich. Das war
jedes Jahr so gewesen. Aber solange wollte sie nicht warten, dachte die
alte Frau und beschloß die Tochter anzurufen. Wo hatte sie nur die
Telefonnummer? Sie war ja selber schuld an der Misere, dachte sie und
lächelte ein wenig. War es doch nicht so, daß die Tochter und die
Enkeltochter sie vernachlässigten. Sie war froh gewesen, allein zu
sein, denn das war sie ihr ganzes Leben nicht gewesen. Ihr Leben lang
hatte sie mit anderen zusammengelebt. Als Kind und Jugendliche bei den
Eltern, wie das normal und üblich ist. Damals herrschten schlimme
Zeiten, es gab Krieg und Faschismus. Der Vater war eingerückt gewesen,
dann lang vermißt und spät zurückgekommen. Sie hatte ihre Matura
knapp nach Ende des dritten Reiches abgelegt, wo alles plötzlich anders
war. Andere Werte und Weisheiten galten, als die, die sie in der Schule
gelernt hatte. Vielleicht hatte sie deshalb Lehrerin werden wollen und
die Lehrerbildungsanstalt absolviert. Aber als sie das Examen in der
Tasche hatte und zu unterrichten beginnen wollte, war die Großmutter
krank geworden und benötigte Pflege und auch der Vater war als kranker
Mann aus dem Krieg zurückgekehrt, von dem er sich nie mehr erholte. So
hatte sie ihre Lehrtätigkeit aufgeschoben, hatte die Großmutter, den
Vater und noch eine Tante gepflegt. Als sie nach dem Tod der Großmutter
in die Schule gehen wollte, hatte sie Erwin kennengelernt und bald
danach Sophie geboren. So war es weitergegangen. Sie hatte Sophie
großgezogen, zwischendurch ein paar Vertretungen gemacht und auch in
einem Kindergarten ausgeholfen, denn der Vater brauchte sie und später
ihre Mutter. Sophie hatte ihr die kleine Ilona überlassen und war froh
gewesen, sich keine Sorgen machen zu müssen, hatte sie es als
alleinerziehende Mutter und arbeitslose Schauspielerin schwer
zurechtzukommen und auch Erwin hatte sie die letzten Jahre sehr
gebraucht. So war statt der Lehrerin eine Hausfrau und Mutter,
beziehungsweise eine Hilfspflegerin aus ihr geworden. Sie wollte nicht
darüber klagen. Hatte sie es ja gern und freiwillig getan und war in
diesen Rollen eine alte Frau geworden, die bald den achtzigsten
Geburtstag feierte. Als sie Erwins Tod so einigermaßen verkraftet
hatte, war sie beinah froh gewesen, daß Ilona noch unverheiratet war
und ihre Hilfe nicht benötigte, so daß sie das Alleineleben genießen
konnte und ihr gar nicht aufgefallen war, daß sie die Tochter und die
Enkeltochter lange nicht gesehen hatte. Es war Zufall und keine böse
Absicht. Sie hatten auch regelmäßig telefoniert und das würde sie
jetzt auch tun, beschloß die alte Frau und erhob sich, um ins
Wohnzimmer zu ihrem Schreibtisch zu gehen, um nach Sophies Telefonnummer
zu suchen. Sie würde der Tochter den seltsamen Brief vorlesen und sich
erkundigen, was sie davon halten sollte? Konnte ihr Vorhaben aber nicht
ausführen, denn es läutete an ihrer Tür.
„Das wird wohl die Tamara sein, die mir einen Artikel bringen
wollte!”, dachte sie.
„Wenn es nicht wieder so eine unangenehme Überraschung, wie dieser
seltsame Geburtstagsbrief ist!” und begab sich zu der Tür, um
vorsichtig aus dem Spion zu schielen, bevor sie öffnete. Es war keine
solche. Sie konnte aufatmen. Draußen stand die Hausmeistertochter
Tamara Rastovic, die Emma kannte, seit sie ihr als kleines Mädchen von
der Hausmeisterfamilie, die aus Serbien stammte, stolz im Kinderwagen
präsentiert worden war. Das war dreißig Jahre her, inzwischen war aus
der jungen Frau, der es gelungen war, trotz Romaherkunft ein
Medizinstudium zu absolvieren, eine Spitalsärztin geworden und da
Tamara sie regelmäßig besuchte, war sie auch gar nicht so allein,
obwohl Erwin und die wenigen Freundinnen gestorben waren und sie die
Tochter und die Enkeltochter im letzten Jahr kaum gesehen hatte. Die
schlanke Frau mit den kurzen dunklen Haaren und der modisch
geschnittenen Viereckbrille, die ihrem Gesicht einen intellektuellen
Ausdruck verlieh, die Jeans trug und eine schwarze Lederjacke, lächelte
Emma ein wenig schüchtern an, als sie die Wohnung betrat.
„Guten Abend, Frau Huber! Habe ich Sie erschreckt? Sie schauen mich so
furchtsam an! Ich hoffe, ich störe nicht, ich wollte Ihnen nur die
Patientenzeitung mit dem Artikel über den wir das letzte Mal gesprochen
haben, bringen. „Volkskrankheit Demenz”, was Sie ja nicht betrifft,
da Sie fitter als manche unserer Patienten sind, die das Pensionsalter
noch nicht erreicht haben und trotzdem schon über Gedächtnisstörungen
klagen!”
Emma hatte der jungen Frau die Türe aufgemacht. Jetzt lächelte sie und
schüttelte den Kopf.
„Komm herein, Tamara! Du störst natürlich nicht. Willst du eine
Tasse Tee? Wenn du direkt von der Klinik kommst, wirst du eine
Erfrischung brauchen. Du schaust sehr müde aus. Gab es Schwierigkeiten
mit dem Chef? Ach ja, die Stelle, du siehst, daß ich doch vergeßlich
bin! Du hast dich um einen Ausbildungsplatz beworben, der heute vergeben
wurde. Darf man gratulieren? Hast du sie bekommen?”
Die junge Frau hatte die Jacke ausgezogen und auf den Garderobeständer
gehängt. Dann schüttelte sie den Kopf und sah noch müder aus oder war
es Zorn und Trauer, die ihren Blick beherrschten?
„Leider nicht, Frau Huber. Die Frau des Oberarztes wurde bevorzugt,
mich hat der Chef auf den Februar vertröstet. Dann soll wieder etwas
frei werden und ich werde berücksichtigt. Bis dahin darf ich warten und
weiter meine Studiendaten eingeben und soll nicht traurig sein, hat der
Chef salbungsvoll gemeint. „Sie machen ja die Telefonambulanz und es
wird Ihnen alles für die Ausbildung angerechnet!”
Aber wissen Sie, Frau Huber, das hat er mir vor einem Jahr auch schon
gesagt und jetzt bin ich bald dreißig, drei Jahre mit dem Studium
fertig und habe mit der Ausbildung noch immer nicht richtig begonnen.
Die Frau des Oberarztes ist jünger als ich und voriges Jahr wurde mir
eine Nichte des Primars vorgezogen. Irgendwann werden sie in meinen
Lebenslauf hineinsehen und „Sie sind schon so alt, Frau Kollegin, was
haben Sie inzwischen gemacht?”, fragen und da ich Lücken aufzuweisen
habe, nicht die Schnellste beim Studieren war und auch erst mit zwölf
aufs Gymnasium gekommen bin, werde ich mit der Antwort Schwierigkeiten
haben. Ich hoffe nur, ich fange nicht zu weinen an und heule Ihnen nicht
den Küchentisch naß. Beim Chef und vor dem Oberarzt habe ich meine Wut
verborgen und die Zähne zusammengebissen und gedacht, du darfst dich
nicht unterkriegen lassen! Aber jetzt ist es mit meiner Beherrschung
bald vorbei!„
Die alte Frau legte der jüngeren den Arm um die Schulter und drückte
sie an sich.
„Komm in die Küche, Tamara. Dann stelle ich Wasser auf und mache uns
eine feine Tasse Pfefferminztee. Der schmeckt dir doch immer. Er
beruhigt und gibt Kraft zum Weiterkämpfen. Du hast schon richtig
gesehen. Es gibt etwas, das mich verwirrt hat. Gut, daß du gekommen
bist, da kann ich dich um Rat fragen. Ich wollte schon die Sophie
anrufen. Aber weißt du, jetzt wirst du lachen und den Kopf schütteln.
Seit die Sophie ein Handy hat, habe ich Schwierigkeiten mir ihre Nummer
zu merken. Die alte habe ich im Kopf, bei der neuen muß ich immer erst
in mein Notizbuch nachschauen gehen. - Aber nimm Platz, ich bringe
gleich den Tee. Natürlich kannst du weinen, das darfst und sollst du
auch! Weinen entspannt und wenn du das, was dich belastet, herausheulst,
hast du wieder Platz im Kopf um deine Gedanken zu ordnen und kannst
weiterplanen!”
Tamara Rastovics Lächeln verstärkte sich, dann setzte sie sich an den
großen Holztisch, auf dem bei den bunten Prospekten das weiße
Briefblatt lag.
„So haben Sie immer zu mir gesagt und es ist auch nicht das erste Mal,
daß ich Ihnen den Küchentisch vollweine. Sie sind ja wie eine
Großmutter zu mir und so habe ich mir eine gute Oma auch immer
vorgestellt. Mit gütigem Blick und weißen Haaren, genau wie das
Klischee aus den Märchenbüchern der kleinen Kinder. Meine Großmutter
habe ich nicht gut gekannt. Ist sie doch mit einigen Tanten und Onkeln
in der Barackensiedlung bei Belgrad geblieben und auch schon gestorben.
Der Vater und die Mutter sind nach Wien gegangen, um ein besseres Leben
zu haben. Dann haben sie, um mir dieses bieten zu können, soviel
gearbeitet, daß ich praktisch in Ihrer Küche groß wurde und immer
gekommen bin, um mich auszuweinen, wenn ich mit den Kindern in der
Schule nicht zurechtgekommen bin, sie mich auslachten und „Was will
die Zigeunerin im Gymnasium, geh doch zurück nach Belgrad!”, gerufen
haben!”
„Ja, Tamara, du hattest es nicht leicht, ich weiß, aber du hast viel
erreicht, sehr viel sogar, das sollst du nicht vergessen!”, sagte die
alte Frau und stellte die Zuckerdose auf den Tisch. Den Brief schob sie
mit den Prospekten an den Rand, um Platz für die Kanne und die Tassen
zu schaffen.
„So haben Sie immer zu mir gesagt! Ich bedanke mich dafür und habe
Ihren Rat auch oft gebraucht. Denn die Lehrerin in der Volksschule hat
mich trotz der vielen Einser, die ich im Zeugnis hatte, für die
Hauptschule vorgesehen. „Das andere überfordert sie!”, hat sie
meinem Vater erklärt. Die Mutter hat sich damals noch nicht in die
Schule getraut und hatte auch keine Zeit, weil sie den ganzen Tag wusch
und putzte, um der Großmutter Geld zu schicken, damit sie in Belgrad
die jüngeren Onkel und Tanten aufziehen konnte. So bin ich zwei Jahre
in der Hauptschule gesessen. Es hat mir weh getan, wenn ich die Kinder,
mit denen ich in der Volksschule war, ins Gymnasium gehen gesehen habe.
Sie haben den Eltern dann zugeredet, mich aufs Gymnasium zu schicken.
„Sie schafft es, das weiß ich!”, haben Sie immer so lieb gesagt.
Und dann ist es fast nicht so geschehen, auch wenn ich gelernt und
gelernt und meine Augen so angestrengt habe, daß ich mir eine
Kurzsichtigkeit geholt habe. Der Schulstoff war es auch nicht. Da war
ich bald Klassenbeste. Aber da haben die anderen „Streberin!” zu
mir gesagt und mich ausgelacht, wenn ich mich vor Anstrengung so
verkrampfte, daß ich schwitzte und die Blusen unter den Achseln
patschnaß wurden. „Die Zigeunerin stinkt!”, haben sie gerufen und
da habe ich Ihnen wieder den Küchentisch naßgeweint und nicht mehr in
die Schule gehen wollen, bin auch ausgetreten und habe eine Lehre als
Arzthelferin begonnen. Aber das war es auch nicht, denn da habe ich in
der Nacht nicht schlafen können, weil ich immer denken mußte, daß ich
so dumm bin und die Schule nicht schaffe. Dabei ist der Sohn von Dr.
Wolfgruber ja in meine frühere Klasse gegangen und war in Mathematik
viel schlechter als ich. Der ist mit seiner Ausbildung übrigens bald
fertig und sicher schon Oberarzt, ehe ich Fachärztin bin. Aber Sie
haben nicht locker gelassen und mir so gut zugeredet, daß ich es ein
Jahr später noch einmal probiert habe und Ihre lieben Worte haben mich
so selbstbewußt gemacht, daß es mit den Kindern der neuen Klasse keine
Schwierigkeiten gab und ich sogar zwei Freundinnen hatte. Aber ich bin
ein Jahr später fertig geworden und die Universität, wo ich mich als
Hausmeisterkind unter lauter Sprößlingen aus Ärztedynastien
durchsetzen mußte, hat mir auch sehr zugesetzt, weil ich glaubte, ich
müßte die Beste sein, um es ihnen zu beweisen. Und so hat es länger
gedauert, weil ich mich erst zu den Prüfungen traute, wenn ich ganz
sicher war, alles zu wissen und jetzt bin ich drei Jahre fertig, hantle
mich von einem Sechsmonatsvertrag zum nächsten, mache für den Oberarzt
Studien und habe noch nicht viele Patienten gesehen. Aber vielen Dank,
Frau Huber! Ohne Sie hätte ich es nicht geschafft! Ohne Sie hätte ich
den Hauptschulabschluß, säße in einer Arztordination und würde dem
Chef die Patienten einteilen. So habe ich Aussicht irgendwann einmal
Internistin zu werden, denn soviel Geld einem praktischen Arzt die
Ordination abzulösen, habe ich nicht und werde es auch nie besitzen und
wenn sich die Mutter noch so sehr bemüht und Tag und Nacht schuftet, um
mir einen guten Start zu bereiten. - Aber genug von mir. Jetzt habe ich
genügend gejammert und es hat mir auch geholfen. Ich bin wieder ganz
entspannt, mache weiter und gebe nicht auf. Vielen Dank für den Tee!
Sie haben recht. Pfefferminze entspannt. Das hat mir früher immer sehr
geholfen, wenn ich an Ihrem Tisch die Hausaufgaben geschrieben habe.
Aber jetzt habe ich Zeit für Sie. Die Zeitschrift habe ich Ihnen auf
das Vorzimmerkästchen gelegt. Erzählen Sie, was Sie berunruhigt! Ist
es der Brief, der am Tisch liegt? Haben Sie schlechte Nachrichten von
Ihren Verwandten? Geht es um Ihre Tochter oder Enkeltochter?”
„Ja und nein!”, antwortete Emma Huber, griff zu dem weißen
Briefblatt, setzte die Brille wieder auf die Nase und las der jungen
Ärztin vor. Tamara Rastovic hörte aufmerksam zu, dann nickte sie.
„Ja, Frau Huber! Da gibt es einen Verrückten, der alten Leuten solche
Briefe schickt. Im Fernsehen haben sie gestern davon berichtet. Ich bin
bei den Eltern gewesen und die haben die Nachrichten gehört. Die Mutter
hat sich auch sehr aufgeregt und erzählt, daß sie bei einem alten
Herrn putzt, der so einen Brief bekommen hat. Aber Sie sollen nicht
nervös werden. Das ist ein Verrückter, meint die Polizei. Sie können
den Brief anzeigen. Regen Sie sich nicht auf und nehmen Sie den Inhalt
nicht persönlich. Vielleicht wollen Sie sich die Nachrichten ansehen,
damit Sie sich informieren können. Wenn Sie wollen, bleibe ich bei
Ihnen und wir schauen sie gemeinsam an. Bei den Eltern bin ich schon
gewesen, die Mutter ist auch noch nicht zu Haus. Jetzt wollte ich in
meine Wohnung hinübergehen. Aber ich leiste Ihnen gerne Gesellschaft,
denn ich wäre in der Wohnung ja allein. Bin ich doch eine schlechte
Romni, die mit fast dreißig Jahren weder einen Mann noch Kinder
hat!”, sagte Tamara Rastovic und lächelte ein wenig mehr. Emma Huber
erwiderte ihren Blick.
„Vielen Dank!”, sagte sie und legte den Brief auf den Tisch zurück.
„Ich rege mich nicht auf, wenn ich auch ein wenig beunruhigt war und
mit dem Brief nichts anfangen konnte. Gehen wir ins Wohnzimmer und
drehen den Apparat auf!”
Alfred Nagl
Last modified: 2008-05-18 22:20:14