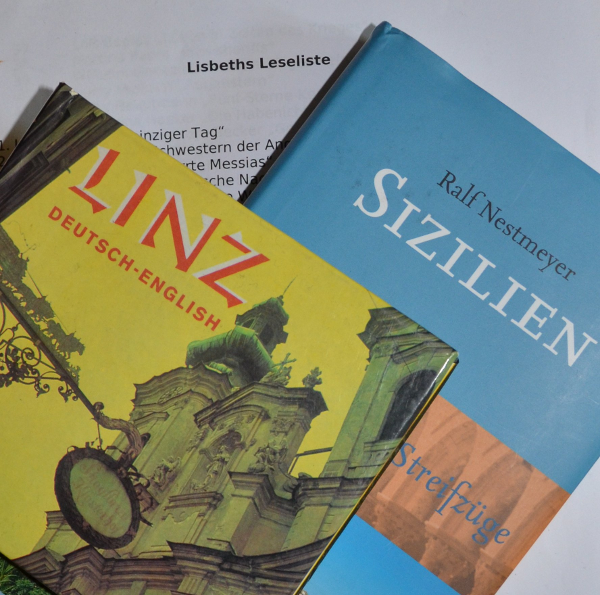Zwillingswelten
„Katharina und Lisbeth sind Zwillingsschwestern, die mit 60 vor einer entscheidenden Veränderung stehen, nämlich am Beginn der Pension, die eine nach ihrer Tätigkeit als Sozialarbeiterin; die andere als Bibliothekarin, die aufgrund des letzten Auftrags ihres vor kurzem verstorbenen Liebhabers die lange Liste ihrer noch ungelesenen Bücher ins Netz gestellt hat, über deren Lektüre sie laufend berichtet, wohl auch, um sich durch solche Lebenszeichen von ihren Depressionen abzulenken und sich öffentlich ans Leben zu binden.
Katharina, die beruflich den helfenden Umgang mit Menschen gewohnt ist, beginnt den neuen Lebensabschnitt mit einer Fahrt nach Linz zum Begräbnis ihrer Mutter. Eine Nachbarin hat sie von deren Tod informiert hat, nachdem sie 30 Jahre nichts von sich hören ließ.
Währenddessen hat sie genug Zeit, sich insistierend und detailgenau an Episoden aus den Fallberichten über zwei ehemalige Klientinnen – Martha und Lenka, die zu ihren Hauptfreundinnen geworden sind – zu erinnern. Obwohl sie aus desolaten Verhältnissen stammen und im Heim aufgewachsen sind, sind sie erfolgreiche Frauen geworden: die eine als Kinderärztin, die andere als Krimischriftstellerin, deren Einladung nach Sizilien Katharina nun folgt.
Die dreiteilige Erzählung endet in Linz, und zwar nicht so, als wäre sie tatsächlich vom Leben geschrieben worden, also mit einer Katastrophe, sondern macht deutlich, dass sich schlimme Familiengeschichten, angeschoben von einigen Zufällen, auch enträtseln und einen versöhnlichen Schluß finden können.“
E. A. Richter
|
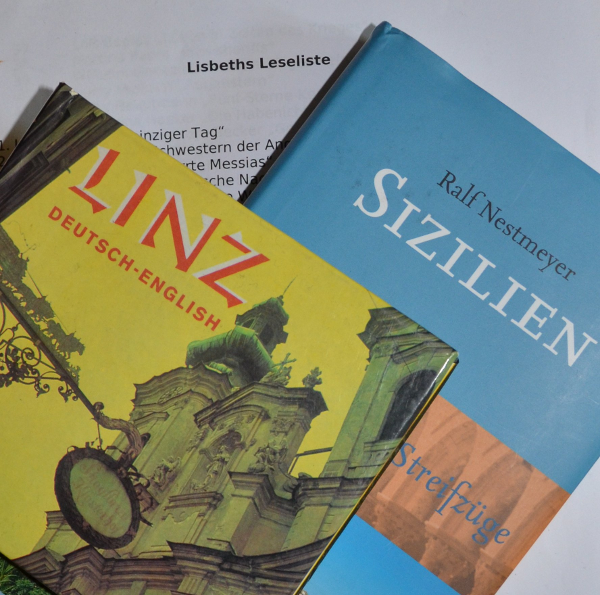 |
Die Personen und die Handlung sind erfunden.
2. Friedhof der ungelesenen Bücher
Als Lisbeth nach Hause kam, fand sie Katharinas Nachricht auf ihrem
Handy vor.
„Richtig!”, dachte sie, stellte die Schuhe auf die Abtropftasse und zog
die dunkle Jacke aus. Jetzt trug sie noch einen schwarzen Rock, die
schwarze Bluse und solche Strümpfe. Passend für das Begräbnis ihrer
Mutter zu dem Katharina gefahren war und wahrscheinlich wissen wollte,
ob sie es bereute nicht mitgekommen zu sein?
Sie tat es nicht und hatte das auch Katharina mitgeteilt, bevor sie auf
den Zentralfriedhof gefahren war.
„Ich will mir das nicht zumuten!”, hatte sie geSMSst und sich mit ihren
Büchern ausgeredet.
„In der Pension werde ich sie ordnen und mir die ungelesenen
vornehmen!”, hatte sie bei der Abschiedsfeier den Kollegen versprochen
und das Sektglas hoch gehoben. Die hatten mit ihr angestoßen und sie
wissen lassen, daß sie das ebenfalls planten, wenn es bei ihnen so weit
wäre. Aber Konrad Steiniger war erst fünfunddreißig und Svetlana Radic
noch ein bißchen jünger. Beide hatten noch viel Zeit und ihr mit
feierlicher Gebärde, das zuletzt erschienene Buch von Peter Handke
überreicht. Eigentlich war es das Vorletzte, denn, daß inzwischen ein
neuer „Handke” erschienen war, hatte sie im Radio gehört. Die Kollegen
hatten es gut gemeint und eine Rede gehalten, daß dieses Buch
hervorragend zu der ehemaligen Bibliothekarin passte denn sie war ja
Germanistin. Auch wenn sie nie als solche gearbeitet hatte, hatte sie
das Fach studiert und eine Dissertation über Peter Handke verfaßt.
„Da kannst du mit dem Lesen beginnen, wir werden dafür sorgen, daß du
nicht so bald fertig wirst!”, hatte Konrad Steiniger, der ihr in der
Leitung nachfolgte, launig versprochen. Dann hatte er ihr eine
Ehrenlesekarte in die Hand gedrückt und hinzugefügt, daß er hoffe, die
sehr verehrte ehemalige Chefin bald unter den Entlehnern begrüßen zu
dürfen. Sie hatte gehofft, sich nicht anmerken zu lassen, daß sie das
nicht plante und die Filiale in der Stumpergasse seither nicht mehr
betreten.
„Aus den Augen aus dem Sinn!”, so hieß es doch. Sie hatte vor den neuen
Lebensabschnitt mit der berühmten Veränderung zu beginnen. Das waren
ihre dreitausend Bücher, die in den zweieinhalb Zimmern ihrer Wohnung
lagerten. Sich eine Liste ihres Friedhofs der ungelesenen Bücher
zulegen, um bei ihrem schwarzen Rock und den ebenso gefärbten Strümpfen
zu verbleiben.
„Es war Richards Idee gewesen!”, dachte sie und konnte nicht verhindern,
daß Tränen in ihre Augen traten. Richard hatte sie dazu gebracht und war
auch Schuld daran, daß sie die letzten drei Monate zu keinem Katalog
gekommen war und kein einziges Buch in Händen gehalten hatte.
Stattdessen war sie im Hospizzentrum der barmherzigen Brüder gesessen
und hatte ihm beim Sterben zugeschaut. Jetzt rannen wirklich Tränen über
ihre Wangen, ließen sich nicht aufhalten und nicht kontrollieren. Sie
wollte es auch nicht. Am Zentralfriedhof hatte sie es noch geschafft,
die trauernde Witwe schluchzen lassen und ihr, nachdem sie die drei
blaßrosa Rosen und das Schäufelchen mit Erde in den Sarg geworfen hatte,
die Hand gereicht.
„Es tut mir leid!”, hatte sie geheuchelt und die Tränen zurückgehalten.
Lore und den beiden Kindern an der Seite, die dreißig Jahre der Grund
gewesen waren, warum Richard, obwohl er es gerne wollte, nicht zu ihr
stehen konnte und sie immer nur als gute Mitarbeiterin ausgegeben hatte,
während die Kollegen über die heimliche Geliebte getuschelt hatten. Das
war es auch, warum sie, als die Hauptbücherei übersiedelt war, nicht
mitging, sondern sich versetzen ließ. Richard hatte ihr die Leitung in
der Stumpergasse verschafft und immer unglücklich über die Umstände
ausgesehen, die verhindert hatten, daß die beiden Königskinder
zusammenkommen konnten. Das war ihnen verwehrt geblieben, obwohl sie
sicher war, daß sie sich in Richard verliebt hatte, als sie ihm das
erste Mal gegenüberstand. Umgekehrt war es genauso gewesen, da gab es
keinen Zweifel. Aber Richard war verheiratet. Hatte zwei Kinder und eine
Hausfrau, die von ihm abhängig war und sich nicht scheiden lassen würde.
So war sie dreißig Jahre die heimliche Geliebte gewesen. Niemand hatte
von ihrem Verhältnis gewußt. Nicht ihre Zwillingsschwester und auch
nicht Lore Haider, obwohl sie, als sie ihr am Grab die Hand gegeben
hatte, nicht mehr so sicher war. Denn Lore hatte sie mit einem Blick
gemustert, in dem die Wahrheit gelegen war und es war auch nicht
wirklich zu verbergen. Hatte sie doch die letzten drei Monate auf der
Hospizstation verbracht und war nur hinausgegangen, wenn Lore und die
Kinder auf Besuch kamen. Richard hatte auch da von der lieben Kollegin
gesprochen, die ihm die Zeitung vorlas und mit ihm über Bücher
diskutierte, um das elende Leben in das der Krebs ihn gestürzt hatte, zu
ertragen. Lore und die Kinder hatten getan, als würden sie es glauben.
Der Blick mit der Lore sie vor ein paar Stunden gemustert hatte, zeigte
aber, daß sie aufgehört hatte, dagegen anzukämpfen.
„Es tut mir so leid!”, hatte Lore Haider zurückgegeben und mit demselben
Blick „Vielen Dank!”, hinzugefügt. Dann hatte sie gefragt, ob sie zum
Leichenschmaus mitkäme? Ein Platz sei für sie reserviert. Richard, da
wäre sie sicher, würde sich das wünschen. Lisbeth hatte den Kopf
geschüttelt und war in die Wohnung gefahren, um am Display ihres Handies
zu ersehen, daß Katharina in Linz angekommen war.
#132;Schlaf gut, liebe Schwester, ich werde dir von dem Begräbnis
berichten!”, hatte sie geSMSst und Lisbeth dachte, daß Katharina sicher
wissen wollte, ob es ihr nicht leid tat, daß sie nicht mitgekommen war?
Tat es nicht, absolut und überhaupt. Ein Begräbnis in der Woche reichte.
Daß sie an Richards Grab gestanden war, den sie die letzten dreißig
Jahre fast jeden Tag gesehen hatte, war selbstverständlich. Die Mutter
hatte sie dagegen dreiunddreißig Jahre nicht gesehen. Da hatte sie sich
vom Vater scheiden lassen und sich in Linz eine Katze zugelegt, der sie
ihr Vermögen vererbte, was lächerlich und peinlich war. Sie hatte keine
Lust sich von der Nachbarin und einem Notar genauso mitleidig gemustert
zu werden, wie es Lore und Richards Kinder vorhin taten.
„Das muß doch einen Grund haben, warum sie ihre Töchter enterbt hat!”,
würden sie tuscheln und wenn sie auch hinzufügen würden, daß die Mutter
diese Katze offenbar sehr lieb gehabt hatte, fehlte trotzdem der
Beweisnotstand. Denn Lisbeth hätte als Kind gerne eine Katze besessen.
Die Mutter hatte es verhindert und so war sie so katzenlos aufgewachsen,
wie ihre Zwillingsschwester. Katharina war das egal gewesen. War die
doch immer die Robustere. Fuhr zum Begräbnis, während sie sich das nicht
zumuten wollte. Ein Begräbnis war genug, das war aber etwas, das sie
Katharina nicht erzählen konnte. Denn es wußte ja niemand, das Richard
mehr als ihr Vorgesetzter gewesen war. Das war ihr Geheimnis, das sie
dreißig Jahre vor der Schwester verborgen hatte, die sie sicher für
neurotisch oder für eine alte Jungfer hielt. Daß es einen Mann in ihrem
Leben gegeben hatte, hatte sie ihr nie zugetraut. Sie konnte es ihr auch
nicht verdenken, denn sie hatte es nie erzählt, sondern die Singlefrau
gespielt und alleine hatte sie tatsächlich ihr ganzes Leben gelebt oder
auch nicht. Richard hatte sich öfter von seinen Dienstreisen einen oder
zwei Tage abgezwickt, die er mit ihr verbrachte. Wenn Lore auf Kur
gewesen war, war er auch zu ihr gekommen. Eigentlich gab es in der
Wohnung vieles, das sie an ihn erinnerte.
Da waren sie schon wieder die Tränen, die ihr die Wangen hinunterrannen.
In der Küche, in der sie sich eine Kanne Tee aufbrühen wollte, erinnerte
das rote Keramikhäferl, aus dem er immer getrunken hatte, an ihn. Im
Schlafzimmer gab es seinen Pyjama, im Bad eine Zahnbürste und einen
Rasierapparat. Alles war vorhanden, obwohl sie es wegschmeißen hätte
können, weil die letzten Monate klar gewesen war, daß er es nicht mehr
benutzen würde. Dreißig Jahre hatte er ihre Hand gedrückt, sie
gestreichelt und „Verzeih mir, Liesel, ich weiß, ich bin ein Feigling.
Ich sollte mich von Lore scheiden lassen und zu dir ziehen und habe
keine andere Entschuldigung, als daß wir Männer keine Helden sind!”, zu
ihr gesagt. So war es auch gewesen. Denn die Mutter hatte vor
dreiunddreißig Jahren keine Bedenken gehabt und ihr und Katharina
vorexerziert, daß man sehr wohl seine Kinder und seinen Ehemann
verlassen kann. Aber sie waren erwachsen gewesen, was Oliver und Selma
damals nicht waren. Nur der Vater hatte am Verlust der Mutter gelitten,
während Richard, das von Lore vermutete und sie noch in der letzten
Woche, als liebe Kollegin ausgegeben hatte, wenn eine Turnusärztin oder
Pflegehelferin sie für die Gattin hielt.
„Verzeih mir, Liesel!”, hatte er sich danach entschuldigt.
„Ich weiß, ich bin ein Egoist!”
Sie hatte den Kopf geschüttelt und verziehen, denn inzwischen war es ihr
egal. Sie hätte ihn nicht mehr geehelicht, wie er ihr manchmal voller
Hoffnung versprochen hatte und es sich auch wirklich wünschte.
„Wenn mich die Lore nicht mehr braucht, werden wir heiraten und unsere
späten Jahre gemeinsam verbringen!”, hatte er öfter versprochen und auch
die Idee mit den Büchern in ihren Kopf gepflanzt, den sie gemeinsam, wie
Philemon und Baucis auflesen würden. Dann war er ein halbes Jahr vor
ihrer Pensionierung an Hodenkrebs erkrankt. Lore hatte ihre Bandscheiben
operieren und ihn auf die Hospizstation verlegen lassen, weil sie ihn
nicht betreuen konnte.
„Das wäre schön, wenn ich die letzte Zeit bei dir verbringen könnte,
aber das will ich dir nicht zumuten!”, hatte der Feigling zu ihr gesagt.
Sie hatte genickt und war ab dem ersten Tag ihrer Pensionierung in der
Hospizstation aufgetaucht und nur aus dem Zimmer gegangen, wenn Lore
oder die Kinder auf Besuch kamen. Zweimal in der Woche hatte das die
liebende Gattin getan, die Kinder waren noch seltener erschienen.
Richard hatte sie als liebe Kollegin vorgestellt, die ihm vorlesen
würde. Lore hatte ihr gedankt und getan, als würde sie es glauben und so
war Lore Witwe geworden, während die Kollegin überblieb und trotzdem
einen Ring am Finger trug, auf der rechten Seite, den sie jetzt auf die
linke Hand steckte.
„Das ist unser Ehering, Liesel! Verzeih mir, daß ich so feige bin,
keinen Standesbeamten oder Priester zu bestellen. Da ich aber bestimmt
nicht mehr solange lebe, bis die Scheidung durchgeführt ist, würden uns
die nicht trauen. So müssen wir es heimlich tun!”, hatte er gesagt, sie
geküßt und dabei geweint. Lisbeth hatte sich den Ring an den Finger
stecken lassen und dachte, während sie das heiße Wasser in das rote
Häferl rinnen ließ, daß Lore den Ring gesehen haben mußte. Sie hatte
nichts gesagt. Aber gewußt, daß Lisbeth die zweite Witwe war, die
illegale und die andere. Immer war sie die Zweite in ihrem Leben. Bei
ihrer Geburt war sie der Zwillingsschwester auch als zweite nachgefolgt
und immer etwas labiler als sie gewesen. Katharina war die tüchtige
Sozialarbeiterin, die lange mit einem Musiker zusammengelebt hatte. Sie
war dagegen als promovierte Germanistin in die Bücherei gegangen, weil
man ihr im Stadtschulrat von einer Anstellung als Lehrerin abgeraten hatte.
„Dafür scheinen Sie nicht energisch genug, sich bei den Kindern
durchzusetzen, Frau Doktor!”, hatte man gesagt und ihr eine
Bibliothekslaufbahn empfohlen. Dort hatte sie sich in Richard verliebt
und war zu spät gekommen, weil er schon drei Jahre verheiratet war und
zwei Kinder hatte. Ihr ganzes Leben war sie die heimliche Braut und alte
Jungfrau geblieben, die Witwe ohne Trauschein und liebe Kollegin. Die
Mutter, die so stark gewesen war, den Vater zu verlassen, hatte ihre
Töchter enterbt. Katharina schien das nicht viel auszumachen, erklärte
ihre Pensionierung mit der Fahrt zum Begräbnis zu beginnen und sie hatte
von einer Depression und Einsamkeit der Mutter gesprochen. Dabei war sie
selber depressiv und einsam. Jetzt war sie auch allein. Allein mit
dreitausend Büchern. Wenn sie in den Supermarkt ging, um Milch und Brot
zu besorgen, würde sie den Pyjama, die Zahnbürste und den Rasierapparat
in den Mistkübel werfen. Oder nein, das würde sie behalten und als
Erinnerung aufbewahren. Die Zahnbürste genauso, wie den Ehering, den er
heimlich von einer Krankenschwester ins Hospizzimmer schmuggeln hatte
lassen. Den Ring würde sie nicht hergeben, auch wenn sie keinen
Trauschein besaß. Sie würde ihn tragen, der Schwester aber nichts
erzählen. Auch nicht, daß sie schon auf einem Begräbnis gewesen war,
also zu keinem zweiten fahren brauchte. Nur von den Büchern würde sie
ihr schreiben, die sie lesen wollte. Wenn sie damit fertig war, konnte
sie die Welt verlassen, weil dann alles erledigt war und es nichts mehr
für sie zu tun gab. Das würde sich die Zwillingsschwester wahrscheinlich
denken, die sie sicherlich für depressiv und neurotisch hielt. Würde
glauben, daß sie sich mit dem Lesen ihrer Bücher aus der Welt
verabschieden wolle, weil es keine Aufgabe für sie mehr gab.
„Tat es auch nicht!”, dachte Lisbeth trotzig und merkte, wie die Tränen
die Bluse und den Rock zu durchnässen begannen, so daß sie ins
Schlafzimmer hinüberhuschte, um sich Richards blau-karierten Pyjama zu
holen, den sie fortan tragen würde und nur die Zahnbürste wegschmeißen,
weil man fremde Zahnbürsten nicht benützen soll. Aber auch daran
brauchte sie sich nicht zu halten. Den Rasierapparat in den
Badezimmerschrank legen und den Pjyama tragen, wie den Ehering am Finger
und den Schnappschuß, das letzte Bild von ihm, auf ihr Bücherregal
stellen. Er sollte ihr beim Sortieren zusehen. Wenn die Bücher gelesen
waren, würde sie ihm folgen. Das war es, was sie ihm drei Stunden vor
seinem Tod, versprochen, was er ihr abgepreßt hatte.
„Versprich mir, Liesel, es zu tun!”, hatte er mit heiserer Stimme von
ihr gefordert, dabei war seine Stirn heiß gewesen, seine zittrige Hand
hatte die ihre fest umklammert.
„Versprich mir, Liesel, das zu tun!”, hatte er gekeucht und ihr wohl
ihre Absicht, sich in der leeren Wohnung zu erhängen oder sich im
Badezimmer die Pulsadern aufzuritzen, von der Nasenspitze abgesehen.
„Versprich es mir!”
Sie hatte genickt und würde ihr Versprechen halten. War sie ja eine
gewissenhafte Person, die nie ein solches gebrochen hatte. Er hatte ihre
Hand geküßt und schien nicht zu merken, daß sie dachte, daß es nicht so
lange dauern könne, bis die Bücher gelesen waren. So viele würden es
nicht sein. Solange konnte sie warten. Hatte sie doch dreißig Jahre auf
ihn gewartet und war in dieser Kunst geübt. Danach würde sie ihm folgen.
Dann hatte sie nichts mehr auf der Welt verloren. Eigentlich könnte sie
es auch beschleunigen, denn wenn sie in der Nacht einschlief und am
Morgen nicht mehr erwachte, hatte sie kein Versprechen gebrochen. Bis
dahin würde sie sich die Bücher vornehmen, die sie gar nicht
interessierten. Da sie nur die Zahnbürste entsorgen wollte, brauchte sie
auch nicht einkaufen. Das hatte sie Richard nicht versprochen. Also
konnte sie zum Frühstück den Tee trinken, der sich in der Kanne befand
oder einen Löffel Assam aus der bemalten Dose in die Kanne leeren und
dabei ihre ungelesenen Bücher erfassen. Damit Katharina ihren guten
Willen sah, würde sie sie auf ihre Homepage stellen. Das konnte sie ihr
schreiben, damit sie beruhigt war und nicht mehr nach dem Begräbnis
fragte. Nach Richards Begräbnis würde sich Katharina nicht erkundigen,
hatte sie ihn ja nicht gekannt und keine Ahnung welche Rolle der
ehemaliger Chef in Lisbeths Leben spielte. Eigentlich war das ein
Klischee. Der Herr Direktor und die Bibliothekarin, denn Sekretärin war
sie genauso wenig gewesen, wie Lehrerin. Schließlich selber Leiterin
einer viel kleineren Filiale, die außer ihr nur zwei Mitarbeiter hatte.
Jetzt wurde sie aus Einsparungsgründen überhaupt nur noch von Konrad und
Svetlana betrieben.
Der Tee schmeckte gut und da sie Richard versprochen hatte, erst ihre
Bücher zu lesen, bevor sie ihm folgte, um, wie die Sterne am Himmel in
Zukunft vereint sein, konnte sie ihn trinken und auch einkaufen gehen,
wenn sie das wollte. Vorläufig wollte sie es nicht. Nichts als in
Richards Pyjama vor dem Bücherregal sitzen und morgen im Pyjama die
Liste erstellen. Jetzt würde sie, wie immer alleine schlafengehen. Denn
sie war ja Junggesellin, keine Witwe und hatte das SMS an Katharina
abgeschickt.
„Gute Nacht, liebe Schwester!”, hatte sie geschrieben und wiederholt,
daß sie ihre Pensionierung mit dem Ordnen ihrer Bücher und nicht mit
einer Reise beginnen wollte.
„Dir wünsche ich alles Liebe!”, formulierte sie höflich, wie sie es ihr
ganzes Leben gewesen war und konnte nicht verhindern, daß die Tränen
immer noch über ihre Wangen kullerten, aber die konnte Katharina nicht
sehen. Nur Richard, der vom Bild zu ihr hinüberlächelte, schüttelte aber
nicht den Kopf und schaute auch nicht traurig, denn es war ein
Sommerbild, das wahrscheinlich von Lore aufgenommen worden war. Er
durfte ihre Tränen auch sehen, denn sie würde sich nicht mehr
verstellen, auch wenn sie ihm geschworen hatte, nicht sofort
nachzufolgen und nicht traurig zu sein. Manche Versprechen waren Lügen
und ließen sich nicht halten. Da würde sie sich kein schlechtes Gewissen
machen. Nur, weil sie sich als Kind eine Katze wünschte, war sie nicht
schuld am Tod der Mutter und auch daran nicht, daß diese alles einer
Katze hinterlassen hatte, die sie als Kind nicht haben durfte.
Als Lisbeth am nächsten Morgen in Richards Pyjama in die Küche kam, war
es nicht besser geworden, so daß sie am liebsten ins Bett
zurückgeflüchtet wäre. Richard fehlte ihr und wahrscheinlich auch die
städtische Büchereifiliale, in die Schulkinder und alte Frauen kamen, um
sich den neuesten Harry Potter oder einen alten Agatha Christie Krimi
auszuleihen. Sie hatte wahrscheinlich einen Pensionsschock, der ihr die
letzten drei Monate, als sie Richard vorgelesen hatte, nicht aufgefallen
war. Jetzt polterte ihr die Decke so intensiv auf den Kopf, daß sie am
liebsten ins Bett zurückgeflüchtet und nicht mehr aufgestanden wäre, wie
die fünf Wünsche einer depressiven Frau gelautet hatten, die sie einmal
in einem Buch gefunden hatte. Am Abend ins Bett zu steigen und am Morgen
nicht mehr aufwachen. Mit der Decke überm Kopf aus der Welt flüchten.
Einfach liegen bleiben und sich totstellen, war sicherlich viel besser,
als mit einem Strick auf den Dachboden schleichen und sich dort
erhängen, obwohl das, Josepha Stock, die einsame Heldin aus dem Buch,
als wirksamste Methode empfohlen hatte. In ihrem Haus hatte es aber
keinen Dachboden gegeben und Lisbeth hatte ebenfalls nicht vor sich auf
diesen zu begeben. Gar nichts hatte sie vor, wie das in der depressiven
Antriebslosigkeit, in der sie sich zu befinden schien, so war. Sie
wunderte sich ein bißchen, wie es die anderen Depressiven schafften, auf
den Dachboden oder mit dem Messer in die Badewanne zu kommen? Sie konnte
das nicht, denn sie hatte sich die ganze Nacht in ihrem Bett gewälzt und
an Richard gedacht. Wenn es ihr doch gelungen war, ein wenig
einzuschlafen, hatte sie von ihm geträumt. Richard ging ihr ab und die
Bücherei. Hatte beides doch die letzten dreißig Jahre ihres Lebens
bestimmt. Beides hatte sie verloren, wie die Mutter sie verlassen hatte,
aber das war egal. Mit Siebenundzwanzig braucht man keine Mutter,
während sie mit Sechzig Richard brauchte, der sie trotzdem verlassen
hatte. Gern hatte er es nicht getan, sondern Tränen in den Augen gehabt,
als er ihr den Ring an den Finger streifte und geflüstert hatte „Ich
glaube, es ist bald soweit, sei nicht traurig, liebe Liesel!”
Da war sie stark gewesen und hatte nicht geweint. Jetzt, wo sie es
durfte, konnte sie nicht. Ihre Augen hatten keine Tränen mehr. Die waren
gestern bis weit nach Mitternacht aus ihr herausgeflossen. Geholfen
hatte es nicht. Sie hatte keine Ahnung, warum sie mit nackten Füßen in
Richards blauem Pyjama in der Küche stand und die Wand anstarrte. Den
Pyjama würde sie nicht ausziehen, nie mehr! Sie würde auch nicht
einkaufen, denn im Pyjama verließen nur die Verrückten und die
Alzheimerpatienten die Wohnung und das war sie beides nicht. Nur
ausgebrannt und allein. Eine Pensionistin, die die Büchereifiliale in
der Stumpergasse nur mehr mit einem Entlehnausweis betreten konnte. Aber
dort ging sie nicht hin. Hatte sie ja in ihren Zimmer dreitausend
Bücher, von denen sie viele nicht gelesen hatte, die sie sortieren
wollte. Wollte sie das wirklich? Sie wollte nicht und auch nicht
frühstücken, sondern in die Erde versinken, sich in Luft auslösen oder
in den Himmel fliegen, auf die Wolke, wo Richard sie erwartete. Das war
verrückt und Richards Bild, im Bücherregal würde sie jetzt sicher
mahnend mustern und den Kopf schütteln.
„Laß dich nicht so gehen, liebe Liesel, das darfst du nicht, du hast es
mir versprochen!”, hörte sie ihm mit heiserer Stimme flüstern, denn die
war ihm in den letzten Tagen seines Lebens ausgegangen.
„Mach dir ein gutes Frühstück, zieh dich an, putze deine Zähne und
erstelle deine Bücherliste. Eine Bibliothekarin sollte alle ihre Bücher
kennen. Damit hast du zu tun und brauchst nicht traurig sein!”,
versuchte er sie pädagogisch zu manipulieren.
Das würde sie so machen oder auch nicht. Den Pyjama würde sie anlassen
und nicht einkaufen gehen. Denn Richard konnte das nicht sehen, lag er
ja unter der Erde am Zentralfriedhof und war nicht in ihrem Zimmer. Die
Stimme in ihrem Kopf war nichts als Einbildung und das hatte sie ihm
auch nicht versprochen. Daß sie die Bücher lesen würde, das andere
nicht. Tee würde sie aber kochen und im Brotkorb nachschauen, ob sie
noch etwas von dem Striezel fand, den sie beim letzten Einkauf besorgt
hatte. Ein großes Stück war davon noch übrig. Sie war zwar nicht
hungrig, ihr ganzes Leben aber diszipliniert gewesen, das legt man auch
im Alter nicht ab. Die Zähne würde sie sich putzen, mehr nicht. Das
waren alle Zugeständnisse zu denen sie fähig war, als sie mit leeren
Augen am Küchentisch saß und beinahe automatisch die Striezelbrocken in
den Mund stopfte, die ihr nicht schmeckten, es war auch egal. Sie
brauchte keine Kräfte und wollte keine Bücher lesen, hatte das Richard
aber blöderweise versprochen und auch Katharina ein solches Mail
geschickt. Also die Teekanne in das Zimmer schleppen, in dem an drei
Wänden Bücherregale standen, an der vierten gab es ein paar
Zimmerpflanzen. Den Urwald in ihrer Wohnung würde sie gießen. Die
Pflanzen konnten nichts für ihre Stimmung und Richards Bild auf dem
Bücherregal nickte ihr auch freundlich zu.
„Guten Morgen, liebe Lisel, du schaffst es und wenn du unbedingt im
Pyjama bleiben willst, ist das erlaubt, hast du mich die letzten Monate
meist auch in einem solchen gesehen oder in dem häßlichen
Trainingsanzug, der an die DDR erinnerte. Zu Hause braucht man kein
Businesskostüm, deine Bücher solltest du aber katalogisieren. Du hast
dich doch dafür interessiert, bist eine bibliophile Libromanin, hast
Germanistik studiert und kennst dich aus! Kopf hoch, Liesel, laß dich
nicht unterkriegen, das Leben geht weiter, du bist noch nicht so alt und
im Gegensatz zu mir kerngesund!”
Richard hatte keine Ahnung, aber die Tränen waren wieder da. Sie konnte
weinen, was besser war und wenn er ihr erlaubte, den Pyjama
anzubehalten, brauchte sie kein schlechtes Gewissen haben, daß sie sich
gehen ließ. Sie hätte ihn ohnehin nicht ausgezogen. Richard war
tolerant. Die Mutter war das nicht gewesen, die hätte diese Schlamperei
nicht geduldet. Hatte auch am Sonntag und in den Ferien von ihren
Töchtern verlangt, bekleidet am Frühstückstisch zu erscheinen. Aber die
Mutter hatte sie schon lang verlassen und würde morgen begraben werden.
Vielleicht sollte sie sich aufraffen und im Pyjama oder angezogen, nach
Linz fahren, weil das von einer guten Tochter so erwartet wird? Das war
sie immer gewesen, trotzdem hatte die Mutter sie enterbt. Sie würde
hierbleiben und hätte es ohnehin nicht zum Bahnhof geschafft. Die Bücher
in den Katalog eintragen, damit sie sie lesen konnte und bald bei
Richard war. Da würde sie die Ersparnisse der Mutter ohnehin nicht
brauchen. Die Katze konnte alles haben, auch wenn das lächerlich klang.
Vollkommen lächerlich, aber so war das Leben. Ein weites Land und
unverständlich, das hatte nicht nur Arthur Schnitzler, sondern auch
Thomas Bernhard so geschrieben, der letztere in noch viel drastischeren
Worten, aber die gehörten jetzt nicht her. Nichts gehörte her, als
Richard und der war auch früher viel zu wenig da gewesen. Wenn es Lore
wie ihr ging, war das auch egal. Aber Lore war nicht traurig und
gebrochen, das war nur sie. Auch das wußte sie nicht so genau, konnte
sie in die Witwe nicht hineinschauen. War keine Psychologin und keine
Therapeutin, nur eine Bibliothekarin und studierte Germanistin. Als
solche würde sie sich zu den Büchern setzen. Vorher einen Schluck Tee
nehmen, der heiß war und nicht schmeckte und den Laptop einschalten.
Katalogisieren hatte sie gelernt. Da war sie in ihrem Element und einen
Bücherkatalog hatte sie auch schon angelegt. Sie mußte nichts tun, als
ihn Stück für Stück durchgehen und eine Liste der ungelesenen Exemplare
erstellen. Wenn das nicht einfach war? Dazu brauchte sie sich nicht
konzentrieren. Was gut war, denn das brachte sie jetzt nicht zusammen.
Nur an Richard konnte sie denken. Richard war die Ausnahme in ihrem
Leben und ohnehin in ihrem Kopf. Den brachte sie von dort nicht heraus,
wollte es auch nicht. Richard konnte bleiben und ihr zusehen, denn sie
sehnte sich nach ihm. Da waren schon wieder die Tränen, die sie am
Computer nicht brauchen konnte. Sie ließen sich nicht vertreiben und so
viele, daß sie die Maschine außer Betrieb setzen könnten, würden schon
nicht fließen. Eigentlich war sie schon ausgeweint. Richards Bild mit
seinen gütigen Augen und dem lieben Lächeln ansehen und mit der Arbeit
beginnen. Das hatte sie gelernt und die letzten dreißig Jahre so
praktiziert. Da war sie auch in ihrer Pension beschäftigt. Das würde
Richard freuen, der das die letzten drei Monate nicht mehr gekonnt hatte
und mit ihr zufrieden sein. Katharina hatte ihr in einem SMS die
Nachricht geschickt, daß sie beim Frühstück einen Architekten namens
Harald Schneider kennengelernt hatte und sich Linz ansehen würde. Sie
ging stattdessen die Bücher durch und hatte auch schon einige gefunden.
Diese Liste würde sie auf ihre Homepage stellen, damit Richard zufrieden
war, dachte sie und spürte eine Leere im Kopf, so daß sie sich
festhalten mußte und die Augen ein wenig schließen.
Die Liste war bald fertig, genau zweihunderfünfzig befanden sich darauf.
Mit den ersten Büchern, den Laptop und einer Kanne Tee konnte sie sich
ins Bett begeben und dort bleiben. Richards Bild mitnehmen und es auf
den Nachttisch stellen. Er konnte ihr zusehen, dann wußte er, daß sie
ihr Versprechen hielt. Nach außen wenigstens, denn im Inneren war sie
auf Rebellion. Die Leseliste würde sie auf ihre Homepage stellen und das
erste Buch ergreifen. Linda Stifts „Kein einziger Tag”. Keine Ahnung,
wie sie dazu gekommen war oder doch. Natürlich wußte sie es. War sie ja
eine ausgezeichnete Bibliothekarin und ihr Gedächtnis funktioniere gut.
Da war von Alzheimer keine Spur. Sie wußte genau, daß das Buch auf den
Neuerscheinungskatalogen stand, die sie in ihren letzten Berufstagen
durchgesehen hatte und als sie, um etwas Bewegung zu machen, zu Fuß von
Richard nach Hause gegangen war, hatte sie das Buch in einer
Buchhandlung gesehen, es am nächsten Tag gekauft und es ihm gezeigt. Sie
hatte es ihm vorlesen wollen. Nur leider war er in den nächsten Tagen so
schwach gewesen, daß es nicht dazu gekommen war. Dann war es vorbei und
sie war in der letzten Woche nicht imstande gewesen, es in die Hand zu
nehmen. Jetzt würde sie es lesen und wenn es sein mußte, auch
besprechen, damit Katharina und die anderen sahen, daß sie ihr
Versprechen hielt und wenn sie mit den Büchern fertig war, würde sie
liegen bleiben und abwarten, bis sie von selbst zu Richard kam. So
einfach war das. Da brauchte sie keinen Strick, kein Messer und keine
Pistole. Sie brauchte nichts als lesen. Dazwischen etwas schlafen und
Tee trinken, solange sich ein solcher in der bunten Dose befand, denn
einkaufen würde sie nicht. Das würde sie sich selbst versprechen. Dafür,
um Richard eine Freude zu machen, der sie, ob dieser aufmüpfigen
Gedanken traurig ansah und den Kopf schüttelte, zu Mittag aufstehen und
alle Packerlsuppen, die sich im Vorratskasten befand, verzehren und wenn
es noch Milch im Kühlschrank gab, würde sie einen Pudding kochen. Nichts
zurücklassen, so sollte es ja sein! Ein Testament brauchte sie nicht.
Katharina würde ihre Bücher erben und konnte sie auch haben, wenn sie
sie wollte. Ihr war das egal und das Buch in ihrer Hand interessierte
sie nicht. Aber weil sie es Richard versprochen hatte, würde sie es
lesen und weil sie es anschließend besprechen wollte, würde sie sich auf
den Inhalt konzentrieren. Danach zu Richard auf die Wolke fliegen oder
einfach liegenbleiben, jawohl, das würde sie so tun! Nicht mehr
aufstehen und sich um nichts mehr kümmern. Wenn die Vorräte in ihrer
Küche nicht für zweihundertfünfzig Bücher reichten, war das auch egal.
Denn sie hatte Richard, der schon wieder traurig schaute, nicht
versprochen einzukaufen und wollte auch kein Jahr, wie sie wohl für die
Bücher brauchen würde, auf ihn warten.
„Ich kann nicht, Lieber, versteh das bitte!”, murmelte sie und schloß,
um den strafenden Blick aus ihren Gesichtsfeld zu entfernen, die Augen,
denn Richards Stimme war nur Einbildung. Er lag auf dem Zentralfriedhof
unter der Erde und konnte sie nicht kontrollieren. Da sie es aber auch
Katharina versprochen hatte, würde sie sich daran halten, wenigstens
vorläufig. Sie öffnete die Augen und griff nach dem Buch. Ganz egal war
es ihr oder auch nicht, denn sie bemühte sich das Gelesene zu verstehen
und schickte Katharina eine Nachricht, daß sie schon mit Lydia
Mischkulnigs „Schwestern der Angst” begonnen hatte. Katharina berichtete
von dem Begräbnis, schrieb von der Katze, die die Nachbarin am Schoß
gehalten hatte, daß sie mit ihr Nußtorte gegessen und sich zwei Krimis
gekauft hatte, weil sie es der Schwester nachmachen wollte und
erkundigte sich, ob Henning Mankell auf ihrer Liste stand? Als ob sie
das interessieren würde? Gar nicht tat sie das, trotzdem schaute sie
gehorsam nach, fand „Die Rückkehr des Tanzlehrers” auf Platz
sechsundfünfzig. Soweit würde sie nicht kommen, konnte aber, um der
Schwester, die ihr inzwischen schrieb, daß sie auf der Reise nach
Trapani sei und in einem Rasthaus Spätzle aß, was sie nicht
interessierte, eine Freude machen und das Buch vorziehen. Mußte es aber
nicht, denn sie brauchte niemanden erfreuen. Nicht mehr. Die Frauen
waren ohnehin zu gutmütig, versuchten ständig alles recht zu machen und
ließen sich viel zu viel gefallen. Vielleicht hätte sie darauf drängen
sollen, daß Richard sich von Lore scheiden ließ? Auch das war egal, denn
dann wäre sie ebenfalls allein. Alles war egal! Trotzdem stand sie auf
und kochte eine Suppe von den letzten Karotten, die sie im Kühlschrank
fand. Kartoffeln waren genug im Haus. Da würde sie lange nicht
verhungern. Wusch das Geschirr und machte neuen Tee, den sie in das rote
Häferl goß, das ihr Richard von einer Bibliothekarstagung aus Berlin
mitgebracht hatte. Die Leiter der großen Filialen waren dazu eingeladen.
Lisbeth war zu Hause geblieben und war da immer noch, während Richard
sie verlassen hatte und da würde sie auch bleiben. Auch die Türe hatte
sie nicht geöffnet, als es geläutet hatte. Warum auch? Sie war im
Pyjama, erwartete niemanden, wollte mit keinem Zeitungskeiler
diskutieren, daß sie auf der Wolke, auf die sie sich demnächst begeben
würde, keine Zeitungen brauchte.
„Versteh bitte, daß ich das nicht will! In meiner Wohnung bin ich
Königin und muß niemanden hereinlassen!”, entgegnete sie auf Richards
vorwurfsvolle Frage trotzig. Er schüttelte den Kopf und sah sie traurig
an. So ging sie, als es das nächste Mal klingelte, sie war ohnehin in
der Küche und hatte Tee gekocht, ins Vorzimmer, waren die Frauen ja
gutmütige Geschöpfe und taten meistens, was sie nicht wollten, öffnete
die Tür und schaute fragend auf den etwa gleichaltrigen Mann, der
unrasiert war und erschöpft wirkte.
„Wollen Sie etwas von mir?”
„Verzeihung!”, sagte er.
„Ich bin Ihr neuer Nachbar, Dr. Franz Riegler!”
Blickte auf ihren Pyjama und den schwarzen Morgenmantel, den sie darüber
geworfen hatte.
„Ich wollte Sie nicht stören, Sie sind schon im Bett gewesen? Es ist ja
schon sehr spät. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Ich bin gerade beim
Einrichten, möchte ein Regal aufstellen und habe keinen Schraubenzieher.
Könnten Sie mir vielleicht aushelfen?”
„Schraubenzieher?”, fragte sie und sah ihn hilflos an.
Ach ja, in ihrem Abstellkammerl befand sich ein Werkzeugkoffer, den sie
nur selten öffnete und noch seltener einen Schraubenzieher brauchte.
Ließ ihn trotzdem eintreten und suchte nach dem Stück. Er bedankte sich
und fügte hinzu, daß er nicht stören wolle und so durcheinander sei, daß
er die einfachsten Regeln der Höflichkeit übersehe.
„Meine Frau hat mich nach dreißig Jahren Ehe einfach von einem Tag zum
anderen hinausgeschmissen. Ich soll mir eine andere Wohnung suchen. Sie
will sich selbst verwirklichen und nicht mehr unterdrücken lassen!”,
sagte er und sah sie hilflos an, die das nicht interessierte. Trotzdem
ließ sie ihn weitersprechen, hörte, daß er Frauenarzt sei, eine volle
Kassenpraxis hatte und durch Vermittlung des Gatten einer Patientin zu
dieser Wohnung gekommen war.
„Sie ist auch eingerichtet, so daß ich mich um nichts kümmern muß und
nur noch ein Regal für meine Bücher brauche”, erklärte er, bedankte sich
und entschuldigte sich noch einmal. Sie schloß die Türe, um sich ins
Bett zurückzuziehen und Richard, bevor sie die Augen schloß, um ein
bißchen zu schlafen, zu fragen, ob er jetzt zufrieden sei, hörte aber
seine Antwort nicht. Alles war ihr egal, der geschiedene Frauenarzt, das
Begräbnis ihrer Mutter und die Bücherliste mit der sie inzwischen zum
„Handke” und zum „Josef Winkler” gekommen war. Die war es ganz
besonders, auch wenn sie alles besprochen hatte. Der Frauenarzt würde
den Schraubenzieher hoffentlich vor ihre Türe legen, damit sie nicht
mehr öffnen mußte.
Irgendwann wachte sie wieder auf und konnte nicht sagen, wie lange sie
geschlafen hatte. Das war nicht wirklich wichtig, weder die Urzeit noch
der Wochentag. Auch Katharina hatte sie länger nicht mehr auf ihre SMS
geantwortet. Nicht einmal auf die Nachrichten geschaut, trotzdem ging
sie ins Bad, putzte die Zähne und stellte sich sogar unter die Dusche,
weil sie offenbar so geschwitzt hatte, daß Richards Pyjama an ihr
klebte. Also warf sie ihn mit den anderen Sachen, die in ihrer
Wäschetruhe lagen in die Waschmaschine, weil sie ihn wieder benützen
wollte und ärgerte sich über ihre Wortbrüchigkeit. Denn es war ja
lächerlich, daß eine, die nichts mehr von der Welt wissen will, ihre
Wäsche schleudert, nur weil sie sich von Richards altem Pyjama nicht
trennen kann. Vollkommen lächerlich war das und verrückt. Zog einen
Hausanzug an und kämmte sich die Haare. Äußerlich war alles in Ordnung,
da konnte ihr niemand den Rückzug anmerken. Da sah sie gepflegter aus,
als der geschiedene Frauenarzt. Aber die Männer waren unpraktische
Geschöpfe, das wußte sie aus Erfahrung, auch wenn sie von Beruf
Bibliotheksleiter und Frauenärzte waren und viel mehr als ihre
Kolleginnen verdienten. Bei dem Thema Frauenarzt fiel ihr ein, daß sie
doch nach draußen schauen und den Schraubenzieher hereinholen sollte,
denn wenn sie den tagelang liegen ließ, kam er vielleicht auf die Idee,
die Polizei zu holen und das wollte sie nicht. Nicht auffallen, lautete
die Devise, wenn auch das nicht wirklich wichtig war. So ging sie nach
draußen, fand den Schraubenzieher nicht, sah aber den Frauenarzt mit
einer Bonbonniere die Stiege hinaufkommen. Da hatte sie sich selber in
die Nesseln gesetzt. Zum Türe zuschlagen war es schon zu spät. Hatte er
sie doch gesehen und ging mit einem verunglückten Lächeln auf sie zu.
„Gut, daß ich Sie treffe!”, sagte er und hielt ihr die Schachtel
Katzenzungen entgegen.
„Ich habe schon bei Ihnen geläutet, um Ihnen den Schraubenzieher
zurückzubringen. Sie waren aber nicht zu Hause oder haben schon
geschlafen. Ich werde ihn gleich holen. Darf ich mir inzwischen erlauben
mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit mit einer Kleinigkeit
revanchieren. Ich hoffe, Sie mögen Katzenzungen?”
Tat sie natürlich nicht, war sie ja kein Kind und eine Katze hätte sie
nur als kleines Mädchen gern einmal gehabt. Damals war das nicht
gegangen, inzwischen hatte eine Katze die Mutter beerbt und sie war
keine Süße und hatte keinen Appetit. Trotzdem „Vielen Dank!”, gesagt.
Die Frauen sind alle verlogene Geschöpfe, und sie blieb stehen, bis er das
Werkzeug aus seiner Wohnung geholt hatte.
„Ich hätte Sie gern auf eine Tasse Kaffee eingeladen, aber den habe ich
nicht zu Haus. Ich fürchte, es ist kein Klischee, daß die Männer
unpraktisch sind!”, sagte er, was sie gerade gedacht hatte.
„Ich bin es wirklich oder sagen wir, ich bin mit meiner Praxis so
überlastet, daß ich mir bisher gern von Frauen helfen ließ. In der
Ordination habe ich meine Assistentinnen. Zu Hause hat bisher Gerlinde
alles gemacht. Jetzt hat sie mich hinausgeworfen und ich muß für mich
selber sorgen, was nicht so schlimm ist. Gibt es ja Lokale, wo ich essen
kann und den Kaffee bereiten mir meine Assistentinnen zu, so habe ich,
muß ich befürchten, einen leeren Kühlschrank, werde aber einkaufen
gehen!”, versprach er ihr, der das egal war und die das nicht tun würde,
aber antwortete, daß sie ebenfalls keinen Kaffee zu Hause habe.
„Nur Tee, wenn Sie damit zufrieden sind, kann ich Ihnen eine Tasse
anbieten!”, hörte sie sich zu ihrem Erstaunen sagen. Ärgerte sich
darüber und noch mehr, daß er ein paar Minuten später in ihrer Küche
stand. Die Rückzugstendenz war ihr nicht anzumerken, hatte sie, wenn sie
gekocht hatte, das Geschirr immer abgespült. Die Frauen waren eben
Gewohnheitstiere, die funktionierten, auch wenn es ihnen beschissen ging.
Die Kanne stand sogar auf den Tisch. So brauchte sie nur frisches Wasser
aufgießen und zwei Schalen ins Wohnzimmer tragen. Auch dort war alles in
Ordnung, die Blumen nicht vertrocknet und die Bücherwände beeindruckten
ihn sehr.
„Sie haben aber viele Bücher!”, sagte er einfallslos, wie alle Männer
waren und sie erklärte, daß sie Bibliothekarin gewesen war und vor drei
Monaten in Pension gegangen. Er nickte und erzählte, daß er darauf etwas
warten müsse, da seine Tochter noch studiere und Gerlinde sicher
Unterhalt von ihm verlange. Er dann aber um die Welt reisen würde. Das
habe er sich schon lange vorgenommen und träume immer, wenn es ihm, wie
beispielsweise jetzt, schlecht ging, davon. Lisbeth dachte wieder, daß
alle Männer das Gleiche wollten und erzählte, daß das ihre Schwester
ebenso mache.
„Ich habe mir vorgenommen meine Bücher zu lesen!”, fügte sie hinzu und
öffnete die Katzenzungenpackung.
„Meine Mutter und ein guter Freund sind gerade gestorben, da bin ich ein
bißchen durcheinander!”, sagte sie zur Erklärung und schaute auf den
Ring an ihrem Finger. Er antwortete verständnisvoll, daß er nicht stören
wolle und sich für den Tee bedanke.
„Morgen habe ich eingekauft. Wenn ich mich revanchieren kann, werde ich
das gerne tun!”, versprach er und sie schüttelte den Kopf, um zu
betonen, daß das nicht nötig sei, legte den Schraubenzieher in den
Werkzeugkasten und hing die Wäsche im Badezimmer auf die Leine. Da würde
sie Richards Pyjama bald wieder anziehen können. Wenn der Frauenarzt
eine große Praxis hatte, war er beschäftigt und würde bei ihr nicht
läuten. Sie würde jedenfalls nicht mehr öffnen, sondern weiterlesen, wie
sie es Richard versprochen hatte. Die Katzenzungen konnte sie ins
Schlafzimmer mitnehmen, dann ersparte sie sich das Kochen einer Suppe
und würde schneller fertig werden, dachte sie, trug die Bücher von Peter
Handke und Josef Winkler ins Wohnzimmer zurück und schaute auf der Liste
nach den nächsten. Jetzt kamen „Jurij Brezan” und „Karl Olsberg” an die
Reihe. Was sich alles in den Regalen einer Bibliothekarin angesammelt
hatte und was sie überhaupt nicht interessierte, dachte sie erstaunt und
zog sich mit dem Vorsatz, dem Frauenarzt das nächste Mal nicht mehr zu
öffnen, ins Bett zurück. Tat es dann zwei Tage später doch. Fast
automatisch war sie zur Tür gegangen, als sie Jurij Brezans „Grüne
Eidechse” ins Regal zurückstellte, um die nächsten Bücher zu holen.
Jetzt hatte sie zwar einige Zeit gelesen, aber schon lange nichts mehr
besprochen und mußte das wieder tun oder eigentlich auch nicht. War sie
ja eine freie Frau, die gar nichts mußte. Sie trug wieder Richards
Pyjama, was sie vielleicht veranlaßte, sich ein bißchen wohler zu
fühlen. Ein Gefühl der Sicherheit gab es ihr auf jeden Fall, während der
Frauenarzt zusammenzuckte.
„Verzeihung, wenn ich wieder störe!”, sagte und sich erkundigte, ob sie
sich nicht wohlfühle und er helfen könne? Da hatte sie es, wenn man
einen Frauenarzt zum Nachbar hat, soll man nicht am Sonntagnachmittag im
Pyjama herumlaufen, auch wenn man sich versprochen hat, diesen nie mehr
abzulegen und Richard hatte sie versprochen, ihre Bücher auszulesen. Die
Frauen waren eben unselbständige Geschöpfe, die sich durch ihre
Versprechen selbst behindern.
„Aber Sie sind in Pension und können sich das leisten!”, scherzte er.
Sie schüttelte den Kopf und begann zu erzählen, daß das Richards Pyjama
sei, der vor zwei Wochen seinem Krebs erlegen sei. Deshalb sei sie in
den letzten drei Monaten nicht viel zum Bücherlesen gekommen, weil sie
das jetzt nicht interessiere. Er nickte.
„Das verstehe ich sehr gut. Dann sollte ich mich verabschieden. Ich
wollte Sie in meine Wohnung bitten und zu einer Jause einladen. Habe ich
doch den Tisch sehr schön gedeckt, Kaffee gekocht und Kuchen aus der
Konditorei geholt. Dann passt das vielleicht nicht!”, sagte er enttäuscht.
„Doch!”, antwortete sie wieder fast gegen ihren Willen.
„Wenn Sie nichts dagegen haben, daß ich Ihnen im Pyjama Gesellschaft
leiste. Ich ziehe den Morgenmantel darüber, dann ist es wie im
Krankenhaus und das sind Sie gewohnt!”
„Selbstverständlich!”,antwortete er und fügte hinzu, daß er auch gerne
im Pyjama herumlaufe.
„Wenn ich ehrlich bin, könnte ich Ihnen erzählen, daß ich mich gerade
erst angezogen habe, als ich zum Essen hinuntergegangen bin und den
Kuchen in der Hoffnung kaufte, daß ich Sie zur Jause einladen kann. Ich
habe sehr viel besorgt, so daß es schade wäre, wenn es überbliebe, denn
ich stehe eigentlich nicht sehr auf Süßes!”
„Natürlich!”, dachte Lisbeth „das machen nur die Frauen, die sich aus
Frust ihr Übergewicht anfressen!” und an die Schachtel Katzenzungen, die
sie inzwischen gegessen hatte. Er führte sie in ein geräumiges Wohnzimmer.
„Sehen Sie, der Tisch ist gedeckt und Kaffee gekocht!”, sagte er und
fügte scherzend hinzu, daß er als Hausmann offenbar Qualitäten habe.
„Wie geht es Ihnen?”, erkundigte sich Lisbeth, nachdem sie Platz
genommen hatte und sich von ihm ein Stück Apfelstrudel auf den Teller
legen und Kaffee einschenken ließ, wobei sie mit Verwunderung bemerkte,
daß sie sich auf den appetitlichen Strudel freute. War ihre Krise schon
vorbei und sie am Ende doch nicht so depressiv, wie gedacht oder hatte
sie nur einfach Hunger? Das Letztere schien zuzutreffen. Schien ihre
Rückzugstendenz schon eine Woche zu dauern und so waren alle Suppen und
Puddingpackerln weggekocht. Vielleicht sollte sie doch einkaufen? Sie
mußte es aber nicht übertreiben. Es reichte sich von dem Frauenarzt zur
Jause einladen zu lassen. Er hatte wirklich gründlich eingekauft und so
stand in der Tischmitte eine große Platte auf der mindestens zehn
Kuchenstücke lagen. Genug für eine Jause und sie brauchte sich nicht
bescheiden. Richard hatte sicher nichts dagegen, wenn sie sich satt aß,
hatte er in den letzten Tagen ohnehin sehr besorgt geschaut und ihr
zugeredet, sich nicht so gehen zu lassen.
„Du mußt auf dich achten, Lisel, versprich mir das!”, hatte er gepredigt
und wenn sie sich auch vorgenommen hatte, nicht auf ihn zu hören,
irgendwann muß Frau sich emanzipieren, wenn sie über sechzig ist, war
die Kuchentafel des Gynäkologen eine gute Gelegenheit sich anzuessen,
dann brauchte sie nicht gleich morgen einkaufen gehen.
„Nicht sehr gut!”, hörte sie ihn antworten.
„Obwohl meine Ehe, wie ich fürchte, doch nicht so perfekt war, wie ich
immer dachte. Gerlinde geht mir nicht ab. Es ist nicht so, daß ich mich
in die Donau stürzen möchte, weil sie mich hinausgeworfen hat!”, sagte
er mit einem nachdenklichen Blick auf sie, als würde er ihr das zutrauen.
„Da trauern Sie wahrscheinlich mehr um ihren Mann!”, vermutete er und
blickte auf den Ring an Ihrer Hand und auf den karierten Herrenpyjama,
der unter ihren Morgenmantel herauslukte.
„Richard war nicht mein Mann. Ich bin nicht verheiratet, sondern die
heimliche Geliebte, die man vor der Welt verstecken muß, obwohl meine
Beziehung zu ihm sehr gut war!”, sagte sie und biß in den Apfelstrudel,
der tatsächlich so schmeckte, wie er aussah.
„Aber das schon dreißig Jahre und so bin ich in Verbindung mit meinen
Pensionsschock tatsächlich etwas durcheinander. Noch dazu ist auch meine
Mutter gestorben. Das traf zwar nicht so sehr, weil ich sie schon Jahre
nicht gesehen habe. Meine Schwester ist zu ihrem Begräbnis gefahren. Ich
habe mich zu meinen Büchern zurückgezogen und eigentlich nicht mehr
aufstehen wollen. Jetzt sitze ich in Ihrem Zimmer, esse Ihren Kuchen und
stelle fest, er schmeckt!”, sagte sie und sah ihn erstaunt an. Er beeilte
sich ein zweites Stück Apfelstrudel auf ihren Teller zu legen.
„Es ist auch von der Konditorei Aida und, daß die ausgezeichnet ist,
höre ich immer von meinen Patientinnen und meinen Vorzimmerdamen. Nehmen
Sie, Ihren Freund wird es freuen, wenn es Ihnen schmeckt und er wird
nichts dagegen haben, daß Sie in meinem Wohnzimmer sitzen, Sie haben ja
seinen Pyjama an!”, behauptete er. Sie nickte.
„Verrückt nicht wahr, aber Sie sind kein Psychiater, sondern Gynäkologe!”
„Daß man nach so einem Verlust traurig sein darf, weiß auch der, selbst,
wenn ich das nach meiner Trennung von Gerlinde nicht sehr bin, sondern
nur lernen muß, Kaffee zu kochen und für mich selbst zu sorgen, was
vergleichsweise nicht sehr schwierig ist!”, scherzte er.
„Dann können Sie mit sich zufrieden sein!”, antwortete sie und merkte,
daß ihr auch der Kaffee schmeckte. Er schüttelte zögernd den Kopf.
„Eigentlich nicht!”, sagte er und fügte hinzu ”Ich weiß gar nicht, ob
ich Ihnen das erzählen soll? Sie werden den Kopf voll mit ihren
Angelegenheiten haben. Da will ich Sie mit meinen Problemen nicht
belasten!”, um ihr von seiner Schwester zu erzählen, zu der es auch
keinen Kontakt gebe.
„Ich habe in den letzten Tagen sehr viel nachgedacht und glaube, daß ich
da eine Leiche im Keller habe, die ich schleunigst holen und begraben
sollte. Obwohl eine Leiche ist es nicht, denn meiner Schwester geht es
sehr gut. Lenka Riegler ist ihr Name. Sie ist Krimiautorin, das sagt
Ihnen als Bibliothekarin sicher etwas?”, vermutete er und sie erinnerte
sich, die Sizilianisch-Wiener Regionalkrimis in der Stumpergasse stehen
gehabt zu haben, die oft gelesen wurden.
„Sie haben sich mit Ihrer Schwester zerstritten und können sich nicht
mit ihr versöhnen?”, vermutete sie.
„Vielleicht sollte ich das. Versöhnen kann man sich ja immer und meine
Schwester hat, glaube ich, gar nichts dagegen, sondern sogar einige
diesbezügliche Versuche unternommen und hält mich wahrscheinlich für
einen sturen Hund, weil ich das bisher verweigerte!”, sagte er und
Lisbeth meinte, daß er das tun könne, wenn sich seine Einstellung
geändert hatte.
„Das sollte ich wohl, da ich merke, daß ich mich davor drückte.
Vielleicht war es auch Gerlinde, die mich bisher gehindert hat. Ich
weiß, man soll den Frauen nicht die Schuld an den eigenen
Unzulänglichkeiten geben. Es ist schon meine Angelegenheit und ich trage
meinen Teil daran. Aber als Lenka noch am Wochenende bei uns gewesen
ist, habe ich gemerkt, daß ihr das gar nicht passte und als es zum Bruch
gekommen ist, hat sie nie etwas dagegen getan, so daß ich dachte, daß es
ihr recht war, daß es so gekommen ist. Aber jetzt hat Gerlinde mein
Leben sehr verändert, daß ich, wenn ich schon neu anfange, vielleicht
eine Inventur durchführen und mich bei meiner Schwester entschuldigen
soll? Was meinen Sie dazu?”, erkundigte er sich und schaute Lisbeth
fragend an, die „Das könnten Sie bestimmt!”, antwortete, obwohl sie das
Problem nicht ganz verstand. Er schien es ihr nicht so genau erzählen zu
wollen, sondern schon genug gesagt zu haben, denn er fuhr sich mit der
Hand über die Stirn, die naß vor Schweiß geworden war, schenkte Kaffee
nach und erkundigte sich, ob er ihr ein Stück Malakoff- oder eine
Obsttore auf den Teller legen sollte?
„Ich fürchte, ich habe schon genug und in den letzten Tagen so
unregelmäßig gegessen, daß ich meinen Magen nicht überlasten sollte!”,
sagte sie und er nickte.
„Dann packe ich Ihnen die anderen Stücke ein, Sie nehmen sie hinüber und
ersparen sich noch einen Tag das Einkaufen. Wenn Sie wollen, können wir
das am Mittwoch gemeinsam erledigen. Das ist mein praxisfreier Tag und
ich muß auch einiges besorgen. Wenn wir gemeinsam in ein Einkaufszentrum
fahren, haben Sie es leichter und brauchen nicht soviel tragen, falls
Sie kein Auto haben sollten!”
„Habe ich nicht, richtig, Sie haben mich durchschaut!”, antwortete
Lisbeth und dachte, daß er ein guter Arzt zu sein schien.
„Dann will ich nicht mehr länger stören und auch in der Aufnahme meiner
Sozialkontakte vorsichtig sein!”, sagte sie und er stand auf, um das
Kuchenpapier zu holen und die Tortenstücke einzupacken.
„Nehmen Sie alle!”, insistierte er.
„Da ich sie wahrscheinlich nicht essen würde und es schade wäre, wenn
sie verderben. Ihnen tun sie vielleicht sehr gut!” und bot ihr an, ihr
beim Tragen zu helfen. Lisbeth hatte keinen Einwand und bemerkte, als
sie auf den Gang traten, daß vor ihrer Türe ein junger Mann stand, der
geläutet zu haben schien und jetzt einen Zettel schrieb.
„Wollen Sie zu mir?”, erkundigte sie sich erstaunt.
„Wenn Sie Frau Dr. Hahnenpichler sind!”, antwortete er erleichtert und
stellte sich als Laurenz Schwarz vor.
„Meine Mutter hat mich geschickt, um nachzufragen, ob alles in Ordnung
ist, da sich Ihre Schwester Sorgen, um Sie macht, weil Sie sie nicht
erreichen konnte. Sie hat gedacht, Sie wären vielleicht krank und ich
solle nachsehen, da ich Medizin studiere!”, scherzte er.
„Sie scheinen mein Fachwissen aber nicht zu brauchen oder sind Sie doch
erkrankt?”, fragte er mit einem Blick auf Ihren Pyjama.
„Nur nicht richtig angezogen!”, antwortete Lisbeth und dachte, daß er
bestimmt etwas Falsches von ihr dachte, was sie aber gar nicht störte
und stellte ihren Nachbarn vor.
„Dr. Riegler, ein Gynäkologe, der sich um mich gekümmert hat!”,
erklärte sie und merkte mit Erstaunen, daß er zusammenzuckte.
„Onkel Franz?”, fragte er verblüfft und sie blickte neugierig auf ihren
Nachbarn, der ebenfalls zusammenzuckte und „So ein Zufall, da scheinen
Sie Besuch von meinem Neffen bekommen zu haben, während ich mich noch
darum drückte, meine Schwester zu kontaktieren. Sie scheinen mir
wirklich Glück zu bringen!”, sagte er und verabschiedete sich, um den
jungen Mann in seine Wohnung zu führen. Sie blieb noch ein wenig stehen
und blickte ihnen verwundert nach. Dann deponierte sie das Kuchenpaket
in die Küche, schaute auf die Uhr und begann sich anzuziehen. Ein Pyjama
war vielleicht doch nicht so passend, wenn man soviel Besuch bekam, auch
wenn es schon Abend war. Da war der Hausanzug unverfänglicher.
„Ich hoffe, das macht dir nichts, Richard?”, fragte sie mit einem Blick
auf das Bild, daß sie, nachdem sie das Bett gemacht hatte, wieder ins
Regal stellte. Das gehörte auch einmal getan und das Zimmer gelüftet.
Also trug sie den Laptop in das Zimmer und suchte nach dem Handy, in das
sie schon lange nicht benützt hatte. Wenn Katharina den Neffen ihres
Nachbarn zu ihr schickte, war es Zeit hineinzusehen und da waren
tatsächlich einige Mitteilungen zu finden. Nicht nur von Katharina, die
ihr von ihrer Reise zu ihrer Freundin, der Krimiautorin Lenka Riegler,
wie hatte sie auf diesen Namen nur vergessen können?, erzählte. Sie nach
ihren Büchern fragte und besorgt war, daß sie schon länger keine mehr
besprochen hatte.
„Es ist alles in Ordnung, liebe Schwester, ich war nur etwas
indisponiert und melde mich wieder!”, tippte sie in das Handy und
registrierte, daß sie noch eine Nachricht von einer Philomena Richter
bekommen hatte. Philomena Richter, wer war das bloß?”, dachte sie ein
wenig hilflos, bis ihr einfiel, daß das die Nachbarin ihrer Mutter war
und die stellte sich auch gleich als solche vor und teilte ihr mit, daß
sie ein Tagebuch der Mutter gefunden hatte und wollte wissen, ob sie
sich es holen oder sie es ihr schicken sollte?
Alfred Nagl